Politische Positionen der HWK für Oberfranken
Karussell-Element
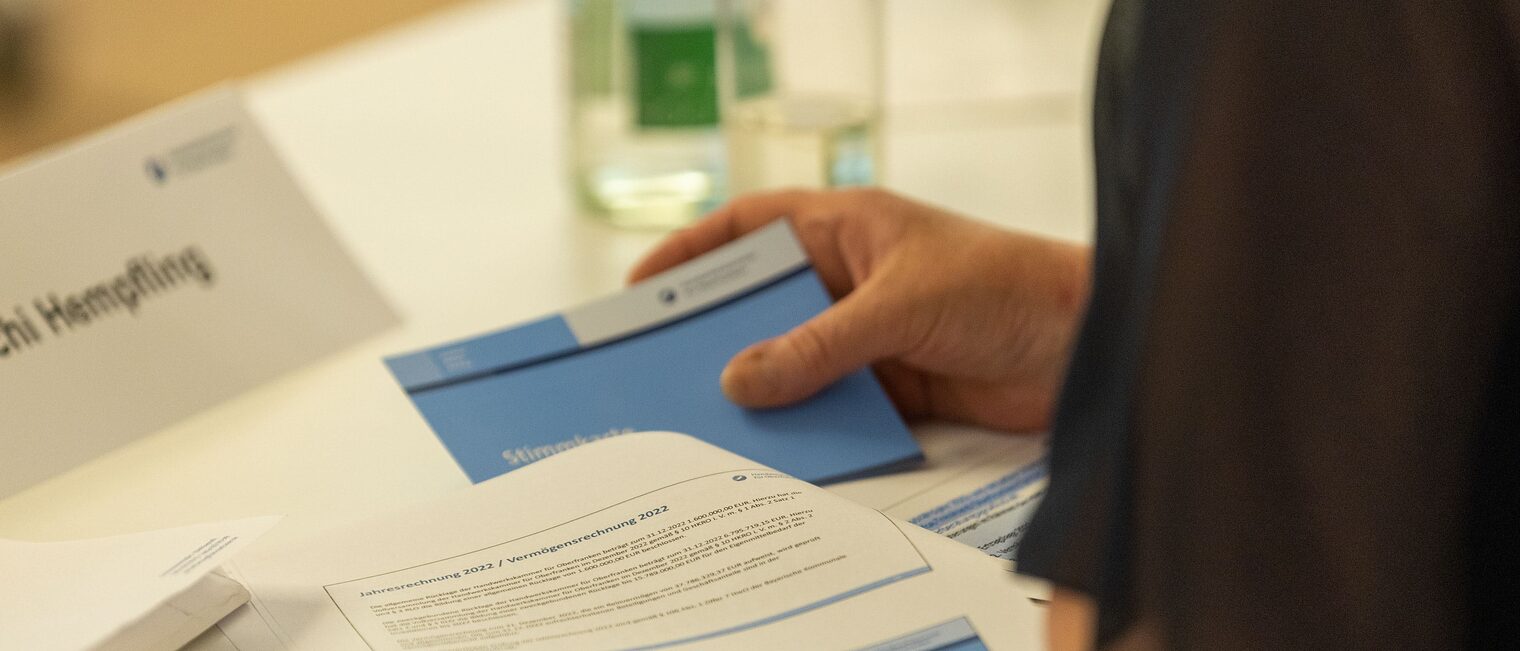
HandwerkspolitikPolitische Positionen der HWK für Oberfranken
Das Handwerk ist das Rückgrat der regionalen Wirtschaft in Oberfranken. Gemeinsam mit starken Partnern wie dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und dem Bayerischen Handwerkstag (BHT) setzen wir uns als Handwerkskammer für Oberfranken dafür ein, die Rahmenbedingungen für unsere Betriebe nachhaltig zu verbessern.
Dazu hat sich die Vollversammlung der HWK für Oberfranken ein Politisches Positionspapier gegeben, dass die zentralen Forderungen des Handwerks skizziert: Von der Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der Digitalisierung bis hin zur Unterstützung einer umweltfreundlichen und zukunftssicheren Energieversorgung.
Das Politische Positionspapier der HWK für Oberfranken wurde im Juli 2023 erstmals beschlossen und wird seitdem jährlich fortgeschrieben.
Das Positionspapier der Handwerkskammer für Oberfranken im Detail:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
a) Wirksame Entlastung von zu hohen Energiepreisen
Weite Teile des Handwerks sind systemrelevant. Produkte und Dienstleistungen des Handwerks müssen dauerhaft zu absatzfähigen Herstellungskosten bereitstellbar bleiben.
Daher fordern wir:
- Ein Strommarktdesign aus einem Guss. Dies umfasst die Senkung der Stromsteuer, eine Reduzierung der im Strompreis integrierten Abgaben (Konzessionsabgabe, Offshore-Umlage, ...) und Netzentgelte sowie ein Aussetzen der CO2-Bepreisung.
- Gedeckelte Energiepreise für Großunternehmen zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit müssen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt bleiben – und dürfen nicht selektiv nur einigen Unternehmen zugutekommen.
b) Sichere Versorgung
Energie ist der Treibstoff der Wirtschaft. Sie muss verlässlich in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.
Daher fordern wir:
- Das Energieangebot muss massiv ausgebaut werden. Es muss der Grundsatz gelten: Kraftwerkskapazitäten werden nur abgeschaltet, wenn andere Leistungen zur Verfügung stehen. Die neue Kraftwerksstrategie und dafür notwendige Investitionsbedingungen gilt es zügig umzusetzen.
- Brückentechnologien müssen genutzt werden! Mit Blick auf Resilienz und Kosten muss ein resilienter Energiemix zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden, der wetterunabhängige Energieträger und Technologien wie Wasserkraft, Tiefen-Geothermie, Biomasse und vorerst auch Kohlekraftwerke umfasst. Mindestens so lange bis Speichertechnologien, Nachfrageflexibilität und Wasserstoffkraftwerke in einem ausreichend skalierbaren Maßstab bereitstehen.
- Kommunen müssen ihre Wärmeplanungen vorantreiben und die regionalen Handwerksorganisationen zwingend von Beginn an beratend mit einbeziehen. Bei der Umsetzung der Wärmeplanung muss das Handwerk mit seinen vielen Gewerken und seiner besonderen Kompetenz bei Bau, Wartung und Management von Gebäuden sowie bei der dezentralen Energie- und Wärmeversorgung eingebunden werden.
- Es braucht über alle Energieträger hinweg dringend den beschleunigten Ausbau der Netze und der Infrastruktur. Es muss gewährleistet sein, dass bei einem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, der E-Mobilität und der Verwendung von Wärmepumpen jederzeit eine stabile Versorgung sichergestellt ist. Damit die Netze die notwendige Flexibilität erhalten, muss der Prozess zum Rollout intelligenter Messsysteme (Smart Meter) beschleunigt und die Digitalisierung der Energiewende insgesamt vorangetrieben werden.
c) Beschleunigung der Klima- und Energiewende
Das Handwerk spielt eine zentrale Rolle bei den Vorhaben zur Klima- und Energiewende. Um energieeffiziente Lösungen zu entwickeln, braucht es ganzheitliche und intelligente Ansätze, die die unterschiedlichen Sektoren der Energiewirtschaft (Strom-, Wärme- und Gasnetze) und der Mobilität vernetzen (Sektorenkopplung). Eine erfolgreiche sektorenübergreifende Planung und Umsetzung ist neben der Reduktion des CO₂-Ausstoßes im Gebäudesektor der Schlüssel zur Klimaneutralität.
Daher fordern wir:
- Die betriebliche Eigenstromversorgung muss gestärkt werden: Steuererleichterungen, schnelle Abschreibungen und verschlankte Förderanträge sind wichtige Bausteine, um Eigenstrom für Betriebe attraktiver auszugestalten.
- Eigenverbrauchern und kleinen Anlagen soll der Zugang zu Herkunftsnachweisen für Grünstrom ermöglicht werden. Der Abbau bürokratischer Hürden erleichtert die Stromweiterleitung in räumlicher Nähe über das Netz der allgemeinen Versorgung. Überschüsse aus einer betrieblichen Photovoltaik-Anlage sollen so zum Beispiel durch Nachbarbetriebe nutzbar gemacht werden.
- Grundsätzlich gilt: Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sollen die Ausbauziele ambitioniert, aber realistisch formuliert werden. Die Entwicklung erneuerbarer Energien sollte mit den Wirkungsmechanismen des Europäischen Emissions-Handels-Systems und den Erfordernissen einer stabilen, versorgungssicheren Netzinfrastruktur in Einklang gebracht werden.
- Sektorenübergreifende Energiemanagementsysteme (EMS) auch für den privaten Bereich.
Die digitale Steuerung der gekoppelten Systeme ermöglicht einen reduzierten und tariflich optimierten Energieverbrauch und entlastet die Netze. - Eine nationale Harmonisierung, Vereinfachung und Beschleunigung der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und Anmeldeverfahren (Netzbetreiber).
- Berücksichtigung des Handwerks in Forschungsprojekten
- Gleichmäßige Verteilung der Kosten der Klima- und Energiepolitik auf alle Unternehmen – unabhängig von deren Größe oder Branche.
d) Energetische Gebäudesanierung vorantreiben
Für eine erfolgreiche Energiewende ist eine Reduktion des Energieverbrauchs unumgänglich. 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und 30 Prozent der CO₂-Emissionen werden in Deutschland durch den Betrieb von Gebäuden verursacht. Energetische Sanierungen von Gebäudehüllen sowie moderne Gebäudetechnik bieten damit ein enormes Potential, das schnell gehoben werden muss. Das Handwerk bietet in diesem Bereich passgenaue Lösungen für eine Wärmewende aus einem Guss, etwa durch passfähige Wärmedämmungen oder Heizanlagen.
Daher fordern wir:
- Die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft muss leichter zugänglich, mittelstandsorientierter und vor allem auch verlässlicher gestaltet werden.
- Betriebe dürfen auch im Bereich der Energieeffizienz nicht mit Berichtspflichten überfordert werden. Daher sollte bei diesen auch weiterhin eine Ausnahme für kleinere und mittlere Unternehmen gelten. Zudem muss auf eine Energieaudit-Pflicht für kleine und mittlere Betriebe verzichtet werden. Mittelstandstaugliche Branchenlösungen müssen national und europäisch konsistent anerkannt werden.
- Die Sektorenkopplung muss der Gesamtlogik der Effizienzsteigerung entsprechen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert auch den Umbau des Energiesystems. Eine besondere Rolle spielen hierbei sektorenübergreifende Verbindungen von Strom, Wärme und Verkehr sowie dezentrale Speicherlösungen. Das Handwerk fordert eine technologieoffene Sektorenkopplung, damit die erneuerbaren Energien optimal genutzt und integriert werden können.
- Bei der energetischen Gebäudesanierung müssen für jedes Gebäude individuelle und technologieoffene Lösungen ermöglicht werden. Die Integration und Gleichbehandlung der verschiedenen Maßnahmen zur energetischen Optimierung der Gebäudehülle müssen in allen Gesetzesvorhaben, welche die Klimawende betreffen, berücksichtigt werden.
- Die Rolle des Fachhandwerks muss gestärkt werden. Eine Beratung durch qualifizierte Fachkräfte des Handwerks ist essenziell für die Steigerung der Energieeffizienz. Der individuelle Sanierungsfahrplan ist dabei nach wie vor der Königsweg zur wirksamen Steigerung der Gebäudeeffizienz. Beratungsleistungen des Handwerks sollen bei allen gesetzlichen Vorgaben entsprechend anerkannt und auch im Rahmen der Förderprogramme angemessen berücksichtigt werden.
- Die Möglichkeiten der Gebäudeenergieberatung durch das Handwerk müssen ausgeweitet werden. Im Rahmen der „Bundesförderung für Energieberatung im Wohngebäude" (EBW), ist eine steuerliche Sanierungsförderung nach §35c EStG über alle Gewerke hinweg umzusetzen.
- Weniger Regulierung und mehr Standardisierung. Dies beinhaltet die schnelle Ausarbeitung technischer Regeln für die sektorenübergreifende Planung, Errichtung, Inbetriebnahme und Wartung von energietechnischen Anlagen in Liegenschaften.
a) Weitere Verstärkung der Berufsorientierung in Realschulen und Gymnasien
Die Berufsorientierung, insbesondere an Realschulen und Gymnasien, ist vor allem im Hinblick auf das Handwerk und seine Möglichkeiten nach wie vor nicht ausreichend.
Daher fordern wir:
- Eine ergebnisoffene, auf die Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler abzielende, wertfreie und verpflichtende Berufsorientierung an Realschulen und Gymnasien.
- Eine Verankerung von Berufspraktika in den Lehrplänen dieser Schulen in der 9. und 10. Jahrgangsstufe
b) Steigerung der Arbeitseffizienz durch intelligente Ansätze und Verzahnungen
Die Umsetzung der Klima- und Energiewende vor Ort erfolgt durch die Fachkräfte des Handwerks. Die schnell fortschreitende Weiterentwicklung der Technologien und Produkte erfordert eine schnellere Anpassung der Lehr- und Lernbedingungen.
Daher fordern wir:
- Die Schaffung gewerkeübergreifender Schulungsstätten in allen Regionen (Energiehaus, Reallabor), an welchen „energetische Handwerke“ (z.B. Zimmerer, Dachdecker, Maurer- und Betonbauer, Schreiner, Maler, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektrotechniker, Kraftfahrzeugmechatroniker) gemeinsam für die neuen Aufgaben qualifiziert werden.
- Für die konzeptionelle Ausarbeitung ist ein Sonderprojekt einzurichten, welches die Anforderungen der gewerkeübergreifenden Ausbildung detailliert herausarbeitet und Vorschläge zur Umsetzung in Schulungsstätten macht.
- Im laufenden technischen Fortschritt werden sich die Anforderungen an diese gewerkübergreifenden Schulungsstätten ändern. Um diese kontinuierlich zu erfassen und die Schulungskonzepte weiterzuentwickeln, ist das Sonderprojekt perspektivisch zu verstetigen.
Um die weniger werdenden, gut qualifizierten Fachkräfte von eigentlich handwerksfernen Pflichten zu entlasten, muss die Arbeitseffizienz durch intelligente Ansätze gesteigert werden.
Daher fordern wir:
- Die frühzeitige Einbindung aller energetischen Maßnahmen und der Energieversorgung bereits in die Vorplanung ab der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 0 und 1).
- Intelligente Schnittstellen zwischen Architekten, Fachplanern, Industrie und dem ausführenden Handwerk.
c) Verbesserung der Mobilität von Auszubildenden und Berufsschülern
Erfolgreiche Wirtschaftsstandorte sind auch erfolgreiche Bildungsstandorte. Beide benötigen eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Diese muss sicherstellen, dass auch die Ausbildungsstätten und Berufsschulen für Auszubildende und Berufsschüler ohne unverhältnismäßige hohe Kosten und ohne hohen zeitlichen Aufwand erreicht werden können.
Daher fordern wir:
- Einen intelligenten Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Oberfranken, der auch kreative Lösungen für die Fläche vorsieht (z.B. Azubi-Taxis).
- Eine Gleichstellung minderjähriger Auszubildender mit Schülerinnen und Schülern.
- Die ergebnisoffene Überprüfung der stillgelegten Bahn-Trassen auf eine mögliche Reaktivierung.
- Die uneingeschränkte Möglichkeit des unbegleiteten Fahrens ab 17 Jahren zur Ausbildungsstätte, Berufsschule und zu Bildungszentren der Handwerkskammer (Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung), insbesondere so lange kein hinreichend gutes ÖPNV-Netz bereitsteht. Die für den Landkreis Coburg gefundene Lösung bildet hierzu erfolgversprechende Ansatzpunkte.
d) Berufsschulstandorte erhalten und Ausbau der Angebote vor Ort durch Bildung von Fachklassen
Ein Ausbildungsplatz im Handwerk muss für junge Menschen attraktiv sein. Hierbei kommt den Berufsschulen eine gewichtige Rolle zu, da sie im Rahmen der dualen Ausbildung als zweiter Lernort viel Raum einnehmen. Für die vornehmlich minderjährigen Auszubildenden spielt deshalb der Ort der Beschulung und somit die Entfernung des Berufsschulstandorts vom Wohnort bzw. vom Ausbildungsbetrieb eine zentrale Rolle.
Daher fordern wir:
- Den Erhalt aller Berufsschulstandorte in Oberfranken
- Ausbau der Angebote vor Ort durch die Einrichtung von Fachklassen an möglichst vielen Standorten
- Schaffung von gewerkeübergreifenden Schulangeboten
e) Erleichterung der Einwanderung ausländischer Fachkräfte
Im Handwerk gibt es eine 250.000 offene Stellen. Viele Betriebe möchten Fachkräfte aus dem Ausland einstellen. In der Praxis stoßen sie vor allem auf bürokratische Hürden.
Daher fordern wir:
- Die Verfahren zur Zuwanderung qualifizierter ausländischer Fachkräfte müssen weiter vereinfacht und beschleunigt werden. Dazu bedarf es einer Verkürzung der Beantragungsfristen und Beschleunigung der Bearbeitung von Visaanträgen vor allem an den migrationspolitisch relevanten deutschen Auslandsvertretungen.
- Die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist seitens der zuständigen Stellen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen zu gewährleisten.
f) Anreize für die Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern, die bereits in Rente sind
Aktuell fehlen im oberfränkischen Handwerk 4.500 Fachkräfte. Es müssen Anreizsysteme für Menschen geschaffen werden, die bereits im Rentenalter sind und sich fit genug fühlen, weiterzuarbeiten.
Daher fordern wir:
- Bei Weiterbeschäftigung interessierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihrem Renteneintritt: Eine Befreiung dieser Tätigkeit von Sozial- und Steuerabgaben.
Die über 500 handwerklichen Berufsbildungszentren (BBZ) in Deutschland sind seit Jahrzehnten ein Garant für das anerkannt hohe Aus-, Fort- und Weiterbildungsniveau des Handwerks. Die Mehrzahl weist inzwischen jedoch einen gravierenden Sanierungs-, Modernisierungs- und Neubaubedarf auf. Dieser beläuft sich auf fast 3 Mrd. Euro. Die erforderlichen grundlegenden Sanierungen und Modernisierungen oder der Neubau vieler Bildungsstätten bedürfen deshalb enormer finanzieller Anstrengungen. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Lösung aus zwei Elementen bestehen muss: einem mittel- bis langfristigen Finanzrahmen, der über einen Zehn-Jahreszeitraum ausreichend Mittel bereitstellt und Planungssicherheit gibt, sowie einer außerordentlichen Anschubfinanzierung, um den bestehenden Investitionsstau aufzulösen.
Daher fordern wir:
- Für eine echte Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung müssen die Förderstrukturen vereinheitlicht werden. Entsprechend müssen auch in der beruflichen Bildung die Investitionen analog zur akademischen Bildung nicht wie bisher zu 75 Prozent, sondern zu 100 Prozent von Bund und Ländern übernommen werden.
- Bis diese Gleichheit in der Förderung vollzogen ist, müssen kurzfristige Maßnahmen ergriffen werden. Ab dem Jahr 2025 müssen die zur Verfügung stehenden Bundesmittel um rund 30 Prozent zum Vorjahresvergleich erhöht werden. Das Bundesmisisterium für Bildung und Forschung will seine Förderung auf jährlich 97 Mio. Euro erhöhen – das Bundesminstierium für Wirtschaft und Energie muss parallel sein Finanzierungsvolumen für die Bildungszentren mit Schwerpunkt Fortbildung auf mindestens 55 Mio. Euro steigern.
- Diese Bundesmittel sind an die Entwicklung des Destatis-Baupreisindex zu koppeln und jährlich neu anzupassen.
- Mit einem Einmalschub „Moderne Lernorte" im Milliardenbereich muss der Investitionsstau in den beruflichen Bildungsstätten aufgelöst werden.
- Darüber hinaus bedarf es vor allem auch einer schnelleren Erlangung von Planungssicherheit: Sobald Fördermittelgeber erkennen können, dass ein berechtigtes Förderinteresse besteht, sollte eine Förderzusage dem Grunde nach erfolgen. Erforderlich ist zudem eine zinslose und finanziell neutrale Übertragbarkeit nicht abgerufener Mittel auf das Folgejahr, falls z.B. wegen einer baulichen Verzögerung die Fördermittel nicht in dem vorgesehenen Kalenderjahr ausgegeben werden können.
- Im Planungsverfahren muss die Investitionssicherheit gesteigert werden. Hierfür müssen Baupreissteigerungen während der Bauphase förderfähig gemacht werden.
- Die einzelnen Stufen des Anzeige-, Antrags- und Genehmigungsverfahrens müssen auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und ggf. gestrichen werden. Das Verfahren ist zu straffen. Ein Zeitraum von 24 Monaten zwischen Anzeige und Bewilligungsbescheid für die Maßnahme sollte die Regel sein.
- Energetische Maßnahmen und erneuerbare Energien-Anlagen sollen generell förderfähig gemacht werden. Seit dem 1. Januar 2024 gilt die Pflicht, in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten nur Heizungen zu installieren, die zu mindestens 65 Prozent auf Erneuerbare Energien basieren. In Anlehnung daran müssen auch energetische Maßnahmen und erneuerbare Energie-Anlagen in Bildungsstätten generell förderfähig sein.
b) Finanzierung der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU)
Die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ist wesentlicher Bestandteil der dualen Ausbildung im Handwerk. Sie trägt dazu bei, die Aus- und Weiterbildung flächendeckend in der notwendigen Breite und Tiefe sicherzustellen.
Daher fordern wir:
- Um eine echte Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu erreichen, müssen die Kosten der ÜLU bis spätestens 2026 im vollen Umfang gefördert werden.
- Der Bund muss bis dahin hinreichend hohe Fördersummen bereitstellen, um die Fördermöglichkeiten der Bayerischen Landesregierung (nachrangig, an primäre Bundesförderung gekoppelt) maximal ausschöpfen zu können.
c) Gleichwertigkeit und Wertschätzung der beruflichen Bildung
Die Berufliche Bildung wurde in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Eine Folge davon ist, dass das öffentliche Bewusstsein und die Wertschätzung der beruflichen Qualifizierung gesunken sind und sich in diesem Zuge weniger junge Menschen für eine Ausbildung entschieden haben. Entsprechend fehlen schon heute gut qualifizierte Fachkräfte. Daher muss die berufliche Bildung politisch und gesellschaftlich wieder den gleichen Stellenwert wie eine akademische Bildung erhalten.
Daher fordern wir:
- Echte Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung, die bei allen Entscheidungen praktiziert wird!
- Endlich Umdenken: Weg von dem finanziellen Fokus auf akademische Bildung und hin zu einer angeglichenen Förderung beruflicher und akademischer Bildungsbereiche z.B. in Bezug auf der Förderung der beruflichen Bildungszentren.
- Ein Jahrzehnt der beruflichen Bildung und damit eine Wende in der Bildungspolitik.
Damit einher geht:
- Verstetigung der verpflichtenden Berufsorientierung Handwerk (Vorbild: Tag des Handwerks an bayerischen Schulen).
- Die Vertiefung und Verstetigung der Berufsorientierung an den Gymnasien inklusive des verpflichtenden Absolvierens von Berufspraktika.
Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister stehen sinnbildlich für die Qualität des deutschen Handwerks und sind Leistungsträger, die sich durch ihre Qualifizierung auf Expertentätigkeiten, auf Führungsaufgaben oder auf ihre Selbstständigkeit vorbereiten. Die Teilhabe an der Meisterprüfung im Handwerk darf nicht an persönlichen finanziellen Voraussetzungen scheitern. Die sehr heterogenen Lebenssituationen der Meisterschülerinnen und -schüler (Alter, familiäre Situation, etc.) bedürfen der gesamten Angebotsvielfalt von Vollzeit- und Teilzeitangeboten mit unterschiedlichen Anteilen des Distanzlernens. Nicht ohne Grund gibt es in manchen Regionen beide Angebotstypen parallel, die auch ihre Nachfrage finden.
Daher fordern wir:
- Die Kostenneutralität der Qualifizierung zum Handwerksmeister, bei Beibehaltung und Weiterentwicklung der bisherigen Fördersystematik, die das Meister-BAföG und den Meisterbonus umfasst
- Diese Förderung muss unabhängig von der Art der Durchführung des Qualifizierungsangebots sein.
Daher fordern wir:
- Allen werdenden Müttern, egal ob selbstständig oder abhängig beschäftigt, müssen Mutterschutzfristen rund um die Geburt eingeräumt werden, in denen sie finanziell abgesichert sind. Der Schutz der Gesundheit der werdenden Mutter und des ungeborenen Lebens müssen für Arbeitnehmerinnen und Selbstständige in gleichem Maß gewährleistet werden!
- Leistungen, wie das Elterngeld, Kinderkrankengeld, Pflegeunterstützungsgeld, ein Darlehen bei Pflegezeit oder Familienpflegezeit, müssen auch die Perspektive von Selbstständigen berücksichtigen. Es bedarf mehr als nur einen Bruchteil der entstehenden Ausfälle auszugleichen, um auch Arbeitnehmern und Selbstständigen ein Familienleben oder zumindest zeitweise die Pflege ihrer Angehörigen zu ermöglichen!
- Kommunen müssen den geltenden Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung durch genug Betreuungsplätze und qualifizierte Betreuer sicherstellen. Die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen müssen sich an den Arbeitszeiten der Eltern und den Bedarfen des regionalen Arbeitsmarktes orientieren.
- Die Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen muss auch berufliche Neu- und Wiedereinsteiger berücksichtigen. Nur mit einer zuverlässigen Kinderbetreuung und mit Planungssicherheit ist eine gezielte Arbeitssuche möglich.
- Schulische Ganztagsangebote sind in ausreichender Anzahl, verlässlich und in einem ausreichenden Stundenumfang wohnortnah zu schaffen.
- Der Kreis der Anspruchsberechtigten für Pflegeunterstützungsgeld bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung und bei der Möglichkeit, ein zinsfreies Darlehen für die Pflegezeit oder die Familienpflegezeit in Anspruch nehmen zu können, muss auch auf Selbstständige ausgedehnt werden.
- Auch bei der Pflege von Angehörigen müssen sich die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen an den Arbeitszeiten der Eltern und den Bedarfen des regionalen Arbeitsmarktes orientieren.
Der aktuelle Bürokratisierungsgrad stellt für kleine und mittlere Unternehmen eine gravierende Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit dar und führt somit zu einer klaren Benachteiligung im Vergleich zu größeren Handels- oder Industrieunternehmen.
Daher fordern wir:
- Entschleunigung der Gesetzgebungsprozesse: Handwerksbetriebe brauchen zeitliche Freiräume, in denen sie nicht ad hoc auf gesetzliche Änderungen reagieren müssen. Gesetze sollten daher einheitlich an einem von zwei Stichtagen im Jahr (z. B. 1. Januar und 1. August) in Kraft treten.
- Gesetze, Formulare und Bescheide müssen verständlich und selbsterklärend formuliert werden. Lässt sich im Einzelfall ein komplexer Rechtstext nicht vermeiden, muss zumindest ein allgemeinverständliches Merkblatt beigefügt werden.
- Es braucht einen grundlegenden Mentalitätswandel von Gesetzgebung und Verwaltungsvollzug hin zu mehr Vertrauen in die Rechtstreue von Betrieben. Daher ist eine Revision aller relevanten Gesetze notwendig. Das bedeutet: konsequente Streichung entsprechender Dokumentationspflichten, deren maßgeblicher Zweck darin besteht, die Rechtstreue im Fall von Prüfungen darlegen zu können.
- Der Gesetzgeber muss das Wissen und die Erfahrung aus der Praxis stärker einbeziehen, um lebensnahe Auswirkungen seiner Vorschriften abschätzen zu können. Das bedeutet: Die Etablierung eines Knowhow-Transfers: Praktikerinnen und Praktiker bringen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Gesetzgebungsvorbereitungen ihre Erfahrung und ihr Praxiswissen ein (Praxischeck). Zusätzlich muss die Evaluierung bestehender Gesetze unter obligatorischer Einbeziehung der betroffenen Kreise ausgeweitet und gestärkt werden.
- Wir fordern die konsequente Umsetzung aller praxisnahen Entlastungsvorschläge des Handwerks, die seit März 2023 vorliegen und geprüft sind.
- One-in-one-out-Regelung auf kommunaler Ebene: Nach dem Vorbild ähnlicher Regelungen auf Bundes- und Landesebene sollten Kommunen ähnliche Regelungen einführen, nach denen für jede neue Regelung mindestens eine alte wegfallen muss.
- E-Government-Instrumente sollten verstärkt eingesetzt werden. Je mehr online erledigt werden kann, desto mehr Zeit und Ressourcen werden gespart – auf allen Seiten. Zudem ermöglichen digitale Prozesse Schnittstellen und eine Mehrfachnutzung bereits vorhandener Daten.
b) Effiziente Vergabepolitik vor Ort
Die Vergabe öffentlicher Aufträge ist ein wichtiges Instrument zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Dabei sollten alle Möglichkeiten ausgenutzt werden, die eine angemessene Beteiligung kleiner und mittlerer regionaler Betriebe möglich machen.
Daher fordern wir:
- Das Ausschöpfen der Wertgrenzen bei Vergaben.
- Deutliche Anhebung der Wertgrenzen für öffentliche Ausschreibungen – zumindest Anpassung der Wertgrenzen an die aktuelle Preisentwicklung.
- Mittelstandsgerechte und konsequente Ausschreibungen in Fach- und Teillosen.
- Ausreichende Planungs- und Umsetzungskapazitäten in der Öffentlichen Verwaltung zur Umsetzung und Betreuung von Bauvorhaben.
- Die Verabschiedung eines Faire-Löhne-Gesetzes für Bayern.
Daher fordern wir:
- Eine Strukturreform der Unternehmensbesteuerung. Diese muss einfacher und strukturierter werden. Die Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften und Personenunternehmen ist im internationalen Vergleich hoch. Ziel muss eine Anpassung der Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland auf ein wettbewerbsfähiges Niveau sein.
- Der Ausgleich der kalten Progression soll jährlich erfolgen.
- Anreize für Investitionen verbessern! Dies kann unter anderem durch verbesserte Abschreibungsverfahren und Verlustverrechnung erfolgen. Die Poolabschreibung sollte deutlich attraktiver ausgestaltet werden, indem die Betragsgrenze angehoben und die Abschreibungsdauer deutlich verkürzt wird. Die Möglichkeit der Verlustverrechnung sollte auf einen Rücktrag von mindestens drei Jahren verbessert werden.
- Eigenkapital stärken! Bei Personenunternehmen sollte die Thesaurierungsbegünstigung verbessert werden. Dies ist vor allem zur Finanzierung von dringend notwendigen Investitionen im Zuge des Transformationsprozesses sowie zur Liquiditätssicherung der Unternehmen in Krisenzeiten von größter Bedeutung. Handlungsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Absenkung der Thesaurierungsbelastung und bei den bestehenden Umstrukturierungshindernissen.
Handwerksbetriebe sind in der Regel standortgebunden und reagieren auf Steuer- oder Abgabenerhöhungen seitens der Kommunen nicht mit sofortiger Abwanderung. Die faire Partnerschaft zwischen Handwerk und Kommunen stabilisiert die Gemeinden und kommunalen Haushalte.
Daher fordern wir:
- Eine moderate Hebesatzpolitik, die keinen Partner überfordert.
- Die Vermeidung aller substanzbesteuernden Elemente, die unabhängig vom Ertrag erhoben werden.
Das Handwerk als lohn- und beschäftigungsintensiver Wirtschaftszweig leistet bereits jetzt einen überproportionalen Beitrag zur Finanzierung der Sozialsysteme. Auch angesichts des Trends zur Automatisierung und der zunehmenden Zahl an digitalen Geschäftsmodellen kann es nicht hingenommen werden, dass die Sozialabgaben auch in Zukunft vor allem an den Faktor "Lohn und Gehalt" gekoppelt bleiben. 2023 hat der Gesamtsozialversicherungsbeitrag die 40-Prozent-Marke und damit die Schmerzgrenze für das Handwerk überschritten. Steigende Sozialabgaben machen die lohnintensive Arbeit, wie sie im Handwerk vorherrscht, immer teurer, nehmen Betrieben wie ihren Beschäftigten finanzielle Spielräume und schwächen die standorttreuen Handwerksbetriebe in ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
Daher fordern wir:
- Das gegenwärtige Finanzierungsmodell der Sozialversicherungssysteme muss grundsätzlich und fraktionsübergreifend auf den Prüfstand gestellt werden mit dem Ziel, den Faktor Arbeit zu entlasten.
- Die alleinige Kopplung der Sozialabgaben an den Faktor "Lohn und Gehalt" muss aufgehoben und eine breitere Berechnungsgrundlage geschaffen werden.
- Eine gute Rente erkennt die Lebensleistung der Menschen an. Die Rente muss zum Leben reichen, nicht nur zum Überleben.
- Deshalb muss das Rentenniveau stabilisiert und perspektivisch wieder angehoben werden.
- Das Rentenalter darf nicht weiter angehoben werden – viele schaffen es schon jetzt nicht, bis 65 oder gar bis 67 insbesondere im Handwerk zu arbeiten.
- Die Gesamtausgaben für die Sozialversicherung dürfen nicht mehr als 40 Prozent des Bruttoeinkommens in die Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung umfassen.
b) Überstunden: Befreiung von der Steuer- und Sozialversicherungspflicht
Der sich immer weiter verschärfende Fachkräftemangel macht es notwendig, dass jede potenzielle Arbeitskraft mobilisiert und genutzt wird. Das kann und muss auch dadurch erreicht werden, zusätzlich geleistete Arbeitsleistung attraktiver zu machen.
Daher fordern wir:
- Eine Befreiung der Überstunden von Sozial- und Steuerabgaben.
c) Altersvorsorgepflicht
Das Handwerk als Wirtschaftszeig ist auch von kleinen Betrieben sowie von Solo-Selbstständigen geprägt. In Zeiten wirtschaftlicher Engpässe laufen Handwerkerinnen und Handwerker Gefahr, die wirtschaftliche Stabilität ihres Betriebes über die eigene Altersvorsorge zu stellen. Dieses uneigennützige Verhalten führt jedoch zu einer wachsenden Gefahr der Altersarmut für die Betroffenen. Auch besteht die Gefahr eines für den Einzelnen ruinösen Wettbewerbs zwischen Betrieben in Zeiten wirtschaftlicher Nachfragezurückhaltung.
Daher fordern wir:
- Wegen der (Solo-)Selbstständigen im Handwerk ohne ausreichende soziale Absicherung sprechen wir uns für die Einführung einer Altersvorsorgepflicht für Selbstständige mit Wahlrecht hinsichtlich des Durchführungsweges aus. Diese Maßnahme würde auch bestehende Fehlanreize reduzieren, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch Formen von Solo-Selbstständigkeit zu ersetzen. Das sorgt für faire Marktbedingungen und reduziert Wettbewerbsverzerrungen.
Aktivitäten

Politische InteressensvertretungLeere Fördertöpfe für Investitionen in handwerkliche Bildungsstätten?

25. Deutsch-Französisches Handwerkskammertreffen in Düsseldorf "Schlüssel für ein starkes Handwerk in Europa"

Politische InteressensvertretungForderung: Handwerk früher in Prozesse einbinden

Politische Interessensvertretung"Deutschland braucht eine Wirtschaftswende!"

Politische Interessensvertretung"Richtige Ansätze, die aber auch umgesetzt werden müssen"

Politische Kommunikation/InfrastrukturBayerischer Abschnitt „gravierende Infrastrukturlücke“

Politische InteressensvertretungWirtschaft@Politik: Jetzt handeln – für unseren Standort Oberfranken

Politische InteressenvertretungVorschläge zum Bürokratieabbau reichen nicht aus

Politische Interessenvertretung Kampagne 2024: Es ist jetzt "Zeit zu machen"
